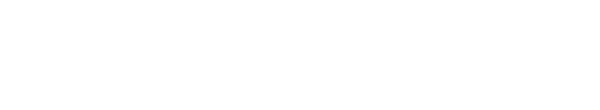(Wien, 08-07-2025) – Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) revolutionieren derzeit die Behandlung zahlreicher Krebserkrankungen. Eine aktuelle Studie der MedUni Wien, durchgeführt am Comprehensive Cancer Center (CCC) der MedUni Wien und des AKH Wien, zeigt nun erstmals, dass Patient:innen mit Rektumkarzinom, die Immuntherapie in Kombination mit Chemoradiotherapie (CRT) erhalten, überraschend häufig eine schwere Muskelschädigung (Myositis) entwickeln.
„Wir haben eine unerwartet hohe Inzidenz dieser Nebenwirkung gefunden“, betonen die Studienleiter Johannes Längle und Michael Bergmann (Klinische Abteilung für Viszeralchirurgie der Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie, CCC). Konkret entwickelten 6 von 50 Patient:innen (12%) eine histologisch bestätigte Myositis. Diese Häufigkeit ist deutlich höher als bisher bekannt: Normalerweise liegt die Inzidenz von Myositis bei ICI bei unter 1%.
Die Ergebnisse stammen aus der prospektiven CHINOREC-Studie, die gemeinsam von Expert:innen der Viszeralchirurgie, Rheumatologie, Kardiologie, Neuropathologie, Pathologie und Radioonkologie durchgeführt wurde. Die Studie wurde nun im Top-Fachjournal „MedComm“ (IF 10.7) publiziert.
Frühe Diagnose durch spezialisierte Biomarker möglich
Die Wissenschafter:innen zeigten, dass eine frühzeitige Identifikation der Myositis durch spezifische Blutwerte gelingt. Gemeinsam mit dem Team rund um Kardiologin Jutta Bergler-Klein (Klinische Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinik für Innere Medizin II) konnten sie erstmals nachweisen, dass das kardiale Troponin cTnI zuverlässig zwischen einer Herzbeteiligung und einer reinen Skelettmuskelbeteiligung unterscheiden kann. Dies stellt einen entscheidenden Fortschritt dar, da bisher eingesetzte Biomarker (wie cTnT) keine ausreichende Spezifität aufwiesen und oft unnötige kardiale Abklärungen nach sich zogen.
Zytotoxische T-Zellen als Hauptursache identifiziert
Eine weitere zentrale Erkenntnis der Studie war, dass diese Form der Myositis durch zytotoxische T-Zellen vermittelt wird. Durch Immunhistologie der Muskelbiopsien konnten die Wissenschafter:innen rund um Erstautorin Rebecca Zirnbauer (Klinische Abteilung für Viszeralchirurgie der Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie, CCC) gemeinsam mit der Neuropathologie (Simon Hametner, Klinische Abteilung für Neuropathologie und Neurochemie, Universitätsklinik für Neurologie) belegen, dass insbesondere CD8-positive T-Zellen die Muskelschäden verursachen. Dies unterscheidet die ICI-induzierte Myositis wesentlich von anderen immunvermittelten Muskelerkrankungen und ermöglicht erstmals eine gezielte Behandlung.
Frühzeitige Therapie verhindert schwere Komplikationen
Aufgrund der potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen der ICI-induzierten Myositis, diese kann unbehandelt eine Sterblichkeitsrate von bis zu 40–50 % aufweisen, ist eine frühzeitige Diagnose und Behandlung unerlässlich. Gemeinsam mit dem Rheumatologie-Team rund um Stephan Blüml und den kürzlich verstorbenen Klaus Machold (Klinische Abteilung für Rheumatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III) konnten die Wissenschafter:innen zeigen, dass nur durch rechtzeitigen Einsatz immunmodulierender Therapien schwere Folgen wie Atemversagen verhindert und gleichzeitig die Tumoroperation erfolgreich durchgeführt werden konnten.
Die Autor:innen der Studie empfehlen daher, künftig bei neoadjuvanter Immuntherapie in Kombination mit CRT regelmäßige Screenings durchzuführen und bereits bei leichten Symptomen und erhöhter Biomarker-Werte rasch diagnostisch und therapeutisch tätig zu werden.
Service: MedComm
Incidence and Immunopathology of Myositis in Rectal Cancer Patients Treated With Neoadjuvant Immune Checkpoint Inhibitors and Chemoradiotherapy: Findings From the CHINOREC Trial. Zirnbauer R, Hametner S, Bergler-Klein J, Kuehrer I, Kulu A, Ammon D, Kabiljo J, Stift A, Schmid R, Müllauer L, Bittermann C, Laengle F, Machold K, Blüml S, Bergmann M, Laengle J. MedComm, 6: e70275. doi: 0.1002/mco2.70275